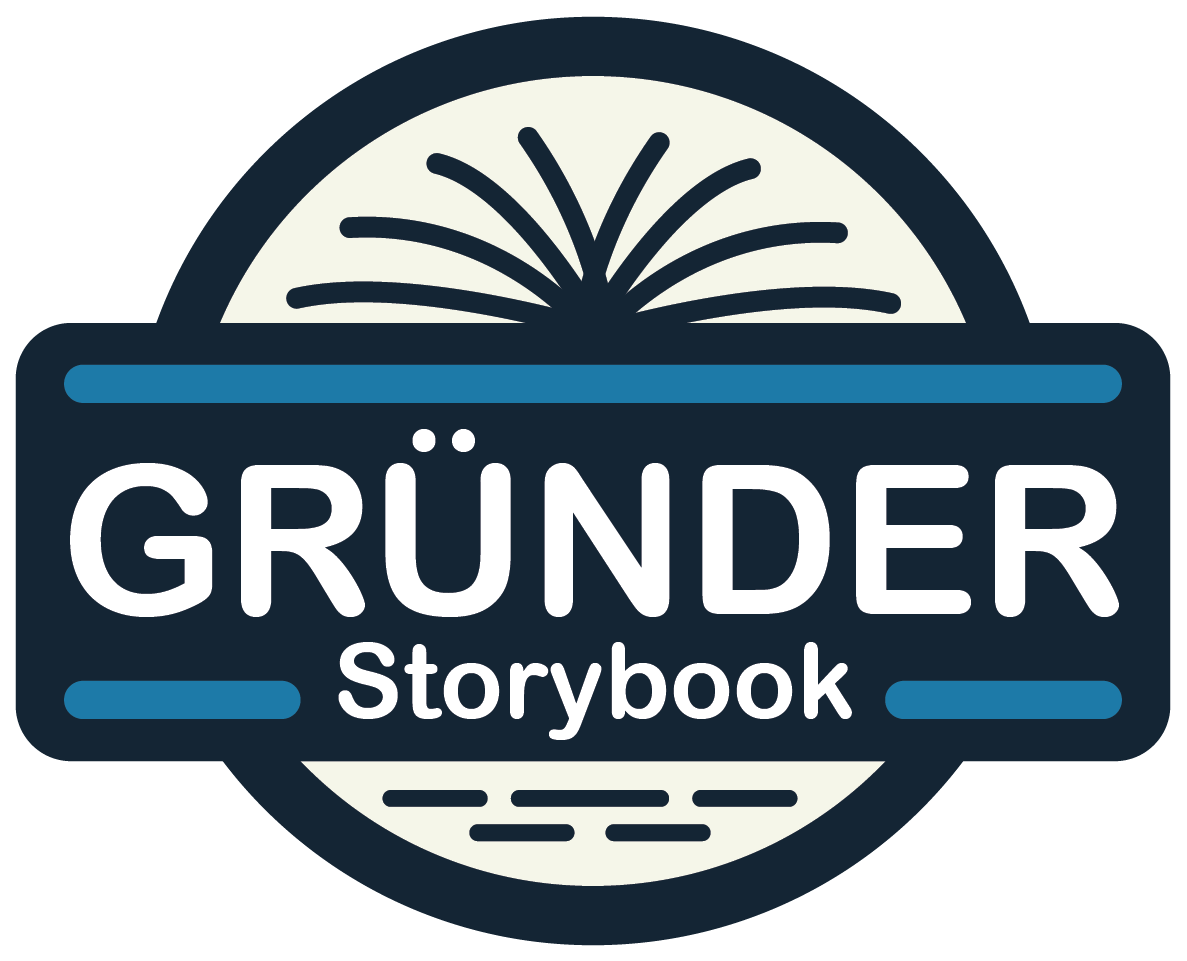Hat das hohe Maß an Flexibilität bei selbstständigen Tätigkeiten einen positiven Effekt auf die Gesundheit? Oder erhöht das Fehlen arbeitsrechtlicher und sozialrechtlicher Regulierung die gesundheitlichen Risiken? Sind Selbstständige in der Gesamtbilanz gesünder als Angestellte? In diesem Beitrag erfährst du, was der aktuelle Forschungsstand zu diesem Thema ist.
Bisherige Studien
Längsschnittstudie „Health and Retirement Study“
Rietveld und van Kippersluis (2015) verwenden in ihrer Analyse die Daten aus der Längsschnittstudie „Health and Retirement Study“. Diese Studie wurde vom Survey Research Center des Instituts für Sozialforschung der Universität von Michigan durchgeführt und vom National Institute on Aging gefördert. Als Indikatoren für die Ausprägung der Gesundheit wurden dabei sowohl subjektive Faktoren (die Selbsteinschätzung der Selbstständigen bzw. der Angestellten) als auch objektive Faktoren (die Anzahl der bisherigen Krankheiten) verwendet.
In ihren Vorüberlegungen definieren die beiden Autoren zwei verschiedene Effekte: den „Benefit Effect“ und den „Barrier Effect“. Wenn sich durch die Analyse der Daten herausstellt, dass beruflich Selbstständige im Durchschnitt gesünder sind als Angestellte, dann sind demzufolge zwei völlig unterschiedliche Erklärungen für diesen Zusammenhang möglich.
– „Benefit Effect“
Demnach sind Selbstständige im Durchschnitt gesünder als Angestellte, eben weil sie selbstständig und nicht angestellt sind. Die Autoren nehmen in diesem Zusammenhang Bezug auf das „Experience Positive Health“ von Karasek und Theorell (1990). Darin werden zwei verschiedene Variablen betrachtet: das Ausmaß an Entscheidungsfreiräumen und das Ausmaß der Belastung. Im Vergleich zu Angestellten verfügen beruflich Selbständigen über ein höheres Maß an Entscheidungsfreiräumen, sind gleichzeitig aber stärker beansprucht.
Rietveld und van Kippersluis (2015) folgern hieraus, dass Entscheidungsfreiräume ein Grund für die bessere Gesundheit der Selbstständigen sein könnten, gleichzeitig aber die höhere Beanspruchung sich ungünstig auf die Gesundheit auswirken kann. Neben dem höheren Stresslevel kann auch die geringere soziale Absicherung der Selbständigen als negativer Effekt auf die Gesundheit identifiziert werden (Finkelstein et al. 2012). Der Benefit-Effekt könnte also vorliegen, wenn der gesundheitliche Vorteil durch die Entscheidungsfreiräume den negativen Effekt vom höheren Stresslevel und der geringeren sozialen Absicherung überwiegt.
– „Barrier Effect“
Demzufolge könnten sich solche Menschen für die Selbstständigkeit entscheiden, die im Durchschnitt gesünder sind als Angestellte. Demnach wäre keine Kausalität, sondern nur eine positive Korrelation zwischen Selbständigkeit und Gesundheit gegeben. Rietveld und van Kippersluis (2015) führen verschiedene Gründe aus, die diesen Zusammenhang erklären können: Erstens haben gesunde Menschen eine höhere Neigung, sich für die Selbstständigkeit zu entscheiden. Zweitens haben Gesunde bessere Möglichkeiten, finanzielle Mittel für eine Unternehmensgründung zu akquirieren. Drittens erhalten Menschen mit gesundheitlichen Risikofaktoren ungünstigere Angebote auf dem privaten Versicherungsmarkt.
Rietveld und van Kippersluis (2015) kommen nach Auswertung der Daten aus der Langzeitstudie zu dem Ergebnis, dass ein positiver Zusammenhang zwischen Selbstständigkeit und Gesundheit ausschließlich auf den „Barrier Effect“ zurückzuführen ist. Die Autoren gehen davon aus, dass Variablen wie zum Beispiel die Risikobereitschaft oder die Ausdauer sowohl die Neigung zur Selbstständigkeit als auch die Gesundheit positiv beeinflussen.
Darüber hinaus diskutieren die beiden Verfasser die Rolle der Gene. Demzufolge ist denkbar, dass bestimmte genetische Faktoren die Bereitschaft zur beruflichen Selbstständigkeit fördern und gleichzeitig die Gesundheit schützen. Hierbei wird Bezug auf die Abhandlung der Autoren Van der Loos et al. (2013) genommen. Die Verfasser gehen davon aus, dass eine genetische Disposition die Entscheidung für die Selbstständigkeit fördert. Rietveld und van Kippersluis (2015) ziehen in ihrer Analyse die Schlussfolgerung, dass ein direkter Einfluss von Selbständigkeit auf die Gesundheit, wenn überhaupt, negativer Art ist.
Zusammenfassend lässt sich aus dieser Studie folgern, dass das Erwerbsmodell Selbstständigkeit überproportional viele Menschen mit einer guten gesundheitlichen Disposition anzieht und dass die Selbständigkeit als solche aber in der Tendenz eher negativ auf den gesundheitlichen Zustand einwirkt.
Analyse der Krankenhausdaten in Portugal
Gonçalves und Martins (2018) haben in ihrer Abhandlung Daten der Social Security Public Agencies of Portugal analysiert. Vom Design her unterscheidet sich die Studie deutlich von der Abahndlung der Autoren Rietveld und van Kippersluis. Als Indikator für die Ausprägung der Gesundheit wird nicht die Selbsteinschätzung verwendet, sondern die Anzahl an Krankenhausaufenthalten. Für den Vergleich zwischen Selbstständigen und Arbeitnehmern wurden Verwaltungsunterlagen aus den Jahren 2005 bis 2011 genutzt. Die Stichprobe umfasst die gesamte arbeitende Bevölkerung in Portugal.
Die Verfasser kommen zu dem Ergebnis, dass Selbstständige im Durchschnitt gesünder sind als Angestellte. Die beiden Verfasser erklären, dass das geringere Erkrankungsrisiko von beruflich Selbstständigen nicht alleine auf den Barrier-Effekt zurückzuführen ist. Die Autoren interpretieren die ausgewerteten Daten als Beleg für die gesundheitsfördernde Wirkung der Flexibilität innerhalb der beruflichen Selbständigkeit. Das höhere Stresslevel wird demzufolge überkompensiert durch die Fähigkeit, freie Entscheidungen zu treffen und die Kontrolle über das Geschehen zu haben.
Den Widerspruch dieser Resultate zu den Ergebnissen von Rietveld und van Kippersluis (2015) erklären die Verfasser mit der unterschiedlichen Methodik der Studien (S.11 f). Auf eine mögliche Verzerrung in ihrer eigenen Studie weisen Gonçalves und Martins hin. Da Industriearbeiter ein höheres Verletzungsrisiko haben und in der Regel angestellt sind, könnte dies den Vergleich zwischen Selbstständigen und Arbeitnehmern ein Stück weit verfälschen (S. 13).
Umfragedaten in den USA
Gegenstand dieser Studie von Yoon und Bernell (2013) sind die Daten aus der in Umfrage “Medical Expenditure Panel Survey” (MEPS) aus dem Jahr 2007. Damals wurde eine repräsentative Stichprobe von US-amerikanischen Bürger befragt. Gegenstand dieser Befragung waren der persönliche Gesundheitszustand, chronische Krankheiten, die Art der Beschäftigung, die Krankenversicherung sowie sozio-demographische Merkmale.
Die Autoren kommen zum gleichen Ergebnis wie Gonçalves und Martins (2018) und begründen diesen Befund mit einem stärkeren Neigung der beruflich Selbstständigen, sich gesundheitsbewusst zu verhalten. Bei der Diskussion möglicher Gründe gehen Yoon und Bernell auf das Merkmal der Flexibilität ein. “We also find that self-employed individuals are more likely than wage-earning individuals to engage in health-promoting activities, perhaps due to greater flexibility in making room for health promotion activities into their schedule. We believe that this finding supports the importance of health behavior in the production of health” (S. 2125).
Demzufolge kann die Möglichkeit zur freien Zeitgestaltung für die Gesundheit förderlich sein. Hieran wird deutlich, dass Selbstständige das Gesundheitsmanagement unter Umständen konsequenter betreiben, als dies in Betrieben möglich ist, selbst wenn sich der Arbeitgeber auf diesem Gebiet engagiert.
Die Verfasser vergleichen ihre Ergebnisse mit früheren Studien aus Schweden, Israel und Deutschland. Hierbei wird deutlich, dass die Erkenntisse über den Zusammenhang zwischen Selbständigkeit und Gesundheit in unterschiedliche Richtungen gehen (S. 2117).
Daten aus dem deutschen Sozio-ökonomischen Panel (SOEP)
Milena Nikolova (2019) hat für ihre Analyse Daten aus dem deutschen Sozio-ökonomischen Panel (SOEP) verwendet, der über den Zeitraum von 2002 bis 2014 geht. Diese Daten beziehen sich auf volljährige Bürger in Deutschland. Die enthaltenen Merkmale sind unter anderem der Gesundheitszustand, der Status auf dem Arbeitsmarkt und das Einkommen.
Die Verfasserin untergliedert Selbsttsändige in zwei Gruppen. Die eine Kategorie besteht aus Personen, die sich aus der Arbeitslosigkeit heraus selbständig gemacht haben. In der anderen Kategorie sind Selbständige, die vorher angestellt waren (S. 664). Außerdem differenziert sie zwischen physischer und mentaler Gesundheit.
Nikolova kommt zu dem Ergebnis, dass Selbstständige, die vorher angestellt waren, durch die Selbstständigkeit im Durchschnitt nun gesünder sind. Dies gilt sowohl für die physische als auch für die mentale Gesundheit. Sie nimmt dabei Bezug auf das Job-Demand-Control-Modell. „The combination of high job demands and high job control enables entrepreneurs to experience positive health benefits overall.“ (S. 682)
Dieses Resultat entspricht in der Tendenz dem Ergebnis der Untersuchung von Yoon und Bernell (2013) sowie der Studie von Gonçalves und Martins (2018). Nikolova bezeichnet diesen Befund als “nicht-monetären Vorteil der Selbständigkeit” (S. 664). Eine Verzerrung der Ergebnisse durch den Barrier-Effekt hält sie für ausgeschlossen. Bei den Selbstständigen, die vorher arbeitslos waren, ist der positive Effekt auf die mentale Gesundheit beschränkt. Auf die physische Gesundheit hat der Übergang von der Arbeitslosigkeit in die Selbständigkeit hingegen keine Auswirkungen.
Fazit
In den bisherigen Studien ist keine eindeutige Tendenz zu erkennen, ob beruflich Selbstständige gesünder sind. Es wird aber deutlich, dass unter den meisten der groß angelegten Studien der vergangenen Jahren häufiger positive als negative Effekte festgestellt wurden. Als besonders komplex erweist sich die Unterscheidung zwischen dem “Benefit Effect“ und dem “Barrier Effect“. Diese beiden Effekte sind bei der Auswertung von Daten schwer voneinander zu trennen. Hierauf weisen die Autoren der bisherigen Studien selbst hin.
Quellen:
Finkelstein, A, Taubman, S, Wright, B, Bernstein, M, Gruber J, Newhouse JP, Allen H & Baicker K, the Oregon Health Study Group (2012). The Oregon Health Insurance Experiment: Evidence from the First Year. Quarterly Journal of Economics. 127(3): 1057–1106
Gonçalves, J, & Martins, P S (2018). The effect of self-employment on health: evidence from longitudinal social security data.
Grunwald, K & Langer, A (Hrsg.) (2018). Sozialwirtschaft. Nomos Verlagsgesellschaft: Baden-Baden
Karasek, RA & Theorell, T. Healthy work (1990). Stress, productivity, and the reconstruction of working life. Basic Books: New York
Koellinger, P D & Thurik, A R (2012). Entrepreneurship and the business cycle. The Review of Economics and Statistics. 94, 1143–1156
Nikolova, M (2019). Switching to self-employment can be good for your health. Journal of Business Venturing, 34(4), 664-69
Pekruhl, U & Vogel. C (2017). Selbstständigerwerbende in der Schweiz – Auswertung des European Working Conditions Survey 2005 und 2015
Van der Loos, MJHM, Rietveld, CA, Eklund, N, Koellinger, PD, Rivadeneira F, Abecasis, GR, Thurik AR (2013). The molecular genetic architecture of self-employment. PLOS ONE
Yoon, J., & Bernell, S. L. (2013). The effect of self-employment on health, access to care, and health behavior.